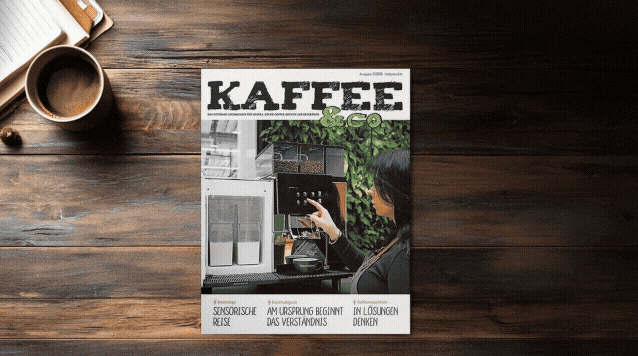Die Gemeinschaftsverpflegung bietet unbestritten großes Potenzial für die nachhaltige Transformation unserer Ernährung. Doch wo gilt es zu starten? Und welche zentralen Hürden sind für eine flächendeckende Umsetzung zu bewältigen? Dem ist ein spezielles Dialogformat namens „DNS-Lab“ auf den Grund gegangen und hat ein Impulspapier dazu veröffentlicht.
Austausch mit Praktikern der Gemeinschaftsverpflegung
Eingeladen hatten zu dem Austausch bereits im Dezember 2024 die Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit (wpn2030), die Technische Universität (TU) Berlin und die Hochschule Osnabrück. Die Ergebnisse sind nun als Impulspapier mit dem Titel „Von der Vision zur Transformation – Impulse für die flächendeckende Umsetzung einer nachhaltigeren Gemeinschaftsverpflegung“ auf zehn Seiten veröffentlicht worden.
Unter den 18 Experten fanden sich neben Vertretern aus Politik/Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auch solche aus der Gemeinschaftsgastronomie (Wirtschaft).
So brachte Daniela Kirsch, Ökotrophologin und Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements beim Bio-Caterer Rebional, ebenso ihre Expertise ein, wie Anna Holters aus dem Vertrieb und der Kundenbetreuung des Bio-Caterers Biond.
Den Care-Bereich vertrat Alexander Mayerhofer, Hotelmanager und Gastgeber von den Waldkliniken Eisenberg.
Aber auch Thomas Voß, der ehemalige kaufmännische Direktor der LWL-Kliniken Münster und Lengerich, und Mitglied im Netzwerk der BioMentoren, der als Nachhaltigkeits-Koryphäe im Care-Bereich gilt, nahm teil.
5 strukturelle Hürden und Herausforderungen für die nachhaltige Transformation
Das Ergebnis des Austauschs per Impuls, anschließender Reflexion und Kleingruppendiskussion: Bislang scheitert die flächendeckende Umsetzung nachhaltiger Ansätze an fünf wesentlichen strukturellen Hürden:
1. Rahmenbedingungen
Heterogene Strukturen und starre rechtliche Vorgaben, insbesondere im Vergaberecht, erschweren die nachhaltige Beschaffung.
Unterschiedliche Bedarfe zwischen städtischen und ländlichen Regionen sowie veraltete Küchenausstattungen hemmen Innovation.
Zudem ist eine besser koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure einschließlich denen vorgelagerter Wertschöpfungsstufen, wie der Landwirtschaft und die Verarbeitung wichtig. Ein effektives Schnittstellenmanagement ist hier unerlässlich.
2. Finanzierungsstrukturen
Höhere Kosten für beispielsweise Bio-Zutaten, neue Geräte oder die Umstellung von Prozessen und Weiterbildung treffen auf enge Budgets. Die Experten empfehlen gezielte Anreize: etwa eine Mehrwertsteueranpassung oder niedrigschwellige Förderungen wie zweckgebundene Zuschüsse oder Nachhaltigkeitsbudgets.
3. Aus- und Weiterbildung
Ein Mangel an qualifiziertem Personal ist eine der größten Hürden. Viele Ausbildungspläne berücksichtigen Nachhaltigkeit kaum. Weiterbildungsangebote in diesem Bereich nehmen zwar zu, müssen aber auch einen niedrigschwelligen Zugang und einen gewinnbringenden Mehrwert sicherstellen.
Praktische Lernorte, etwa Trainingszentren für Küchenteams zur praktischen Umsetzung von nachhaltigen Rezepturen und Zubereitungstechniken, könnten Abhilfe schaffen.
Zusätzlich kann ein offener, horizontaler wie vertikaler Austausch durch gegenseitiges voneinander Lernen unterstützen.
4. Ernährungsumgebungen
Die nachhaltige Speisenwahl muss leicht zugänglich, lecker und attraktiv sein. Begriffe wie „Verzicht“ erzeugen Widerstand, während günstige, ansprechend präsentierte Gerichte motivieren, Neues auszuprobieren.
5. Food Literacy
Verpflegungseinrichtungen können Bildungsorte sein. Wenn Gäste den Verzehr nachhaltiger Mahlzeiten in der Gemeinschaftsverpflegung positiv erleben, nehmen sie dieses Wissen mit in den privaten Alltag.
Ein weiterer Ansatz kann die übergreifende Integration von landwirtschaftlichen Kompetenzen und Ernährungsthemen in bestehende Schulfächer bzw. den Unterricht sein.
Vier priorisierte Handlungsansätze mit Praxisbezug
1. Positive Narrative stärken
Verständliche, authentische Botschaften wie „nach Omas Rezept“ schaffen Vertrauen. Persönliche Geschichten von z. B. Erzeugern und Lieferanten sowie regionale Bezüge, z. B. zur Herkunft, wecken Emotionen und Vertrauen – ideal für das sogenannte „Storytelling” per interner Kommunikation, auf den Speiseplänen oder dem Intranet bzw. der Website. Es gilt die Menschen in ihrem Alltag ansprechen und gleichwohl die Heterogenität der Zielgruppen in der Ansprache zu berücksichtigen.
2. Nachhaltigkeit als Standard etablieren
Hierbei geht es darum, nachhaltiges Handeln zur naheliegenden und überzeugenden Option zu machen und für alle zu ermöglichen. Ausgangspunkt könnte die flächendeckende Umsetzung von den DGE-Qualitätsstandards oder der Planetary Health Diet sein, welche Ernährungsempfehlungen mit Nachhaltigkeitskriterien verbinden.
Standardisierte Nachhaltigkeitskriterien im Einkauf, wie der Bezug von saisonalem Gemüse und Obst möglichst aus ökologischer bzw. fairer Produktion, unterstützen den Ansatz, Nachhaltigkeit als Standard zu etablieren.
Finanzielle Anreize und staatlich geförderte Beratungsprogramme sind ein weiterer Treiber.
Auch die Forderung derartiger Standards in Ausschreibungen könnte die Transformation beschleunigen.
Für die Akzeptanz durch die Gäste ist es wichtig, dass nachhaltige Speisenangebote leicht zugänglich sind und optisch sowie geschmacklich überzeugen.
3. Ökonomische Anreize auf Lebensmittelebene setzen
Eine differenzierte Mehrwertsteuer wie ein Nullsteuersatz auf pflanzliche, gering verarbeitete Produkte könnte nachhaltige Menüs fördern und finanzielle Hürden abbauen. Denkbar ist alternativ eine nachhaltigkeitsbezogene Abgabe, z. B. je nach CO2-Emissionen, Flächenverbrauch oder Auswirkung auf die Biodiversität. Beide Ansätze gehen über die Gemeinschaftsverpflegung als Zielgruppe hinaus, könnten jedoch gerade hier eine Schlüsselrolle spielen.
4. Multiprofessionelle Lotsenstellen schaffen
Es besteht ein klarer Bedarf an Kontinuität und übergeordneter Struktur, die langfristig für Bündelung, Austausch und Breitenwirkung auch von befristeten oder projektbezogenen Initiativen sorgt. Eine multiprofessionelle Lotsenstelle auf Landesebene könnte den Austausch zwischen Akteuren erleichtern sowie Beratung, Wissenstransfer und Netzwerke koordinieren.
Sie kann auf bestehenden Strukturen wie den etablierten Vernetzungsstellen aufbauen, sollte jedoch in ihrem Tätigkeitsfeld und ihrer Reichweite darüber hinausgehen.
Um Entwicklungen und Veränderungen effektiv vorantreiben zu können, sollten die Finanzstrukturen idealerweise langfristig auf mehr als fünf Jahre ausgelegt sein und durch ein geeignetes Geschäftsmodell auch eine langfristige Verstetigung sicherstellen.
Ein unabhängiges Monitoring, z. B. durch Hochschulen, könnte die Weiterentwicklung begleiten.
Relevanz für die Praxis
Für Küchenteams und Entscheidungsträger in der Gemeinschaftsgastronomie bieten diese Ergebnisse folgende konkrete Ansätze zur Umsetzung:
- Nachhaltigkeit als Qualitätsmerkmal etablieren: Berücksichtigung von regionalen und saisonalen Produkten sowie pflanzenbasierten Optionen
- Teamfortbildungen zu nachhaltigen Kochmethoden initiieren oder Schulungsangebote nutzen
- Gäste aktiv einbeziehen, z. B. durch Storytelling über Speisepläne
- Netzwerkbildung: Austausch mit anderen Einrichtungen und Teilnahme an multiprofessionellen Netzwerken zur Förderung nachhaltiger Praktiken.
Fazit des Impulspapiers
Die im DNS-Lab erarbeiteten Ansätze zeigen auf: Eine nachhaltige und flächendeckende Transformation Gemeinschaftsverpflegung ist machbare Realität. Vorausgesetzt, die strukturellen Stellschrauben werden richtig gestellt und die Praktiker vor Ort erhalten die nötige (finanzielle) Unterstützung, Motivation – und Gestaltungsmacht.
Weiterentwicklung Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2025
Am 17.02.2025 wurde die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2025 veröffentlicht. Zu dieser hat sich auch die neue Bundesregierung im Rahmen ihres Koalitionsvertrags bekannt. Für die Gemeinschaftsverpflegung stehen im Transformationsbereich nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme die folgenden Themen im Fokus:
- die Umsetzung der DGE-Qualitätsstandards,
- die Förderung innovativer Konzepte in Regionen sowie deren Verbreitung (Modellregionenwettbewerb) und
- die Steigerung der Nachfrage nach saisonalen Bio-Lebensmitteln.
Die im Impulspapier beschriebenen Handlungsansätze können einen positiven Beitrag zu diesen Themen leisten, gehen aber zugleich darüber hinaus. Mit dem Ziel, die flächendeckende Umsetzung einer nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung zu unterstützen, adressiert das Papier übergeordnete, zentrale Stellschrauben wie Bildung und Kompetenzaufbau, Teilhabe, Vernetzung, Kapazitäten und Finanzierung.
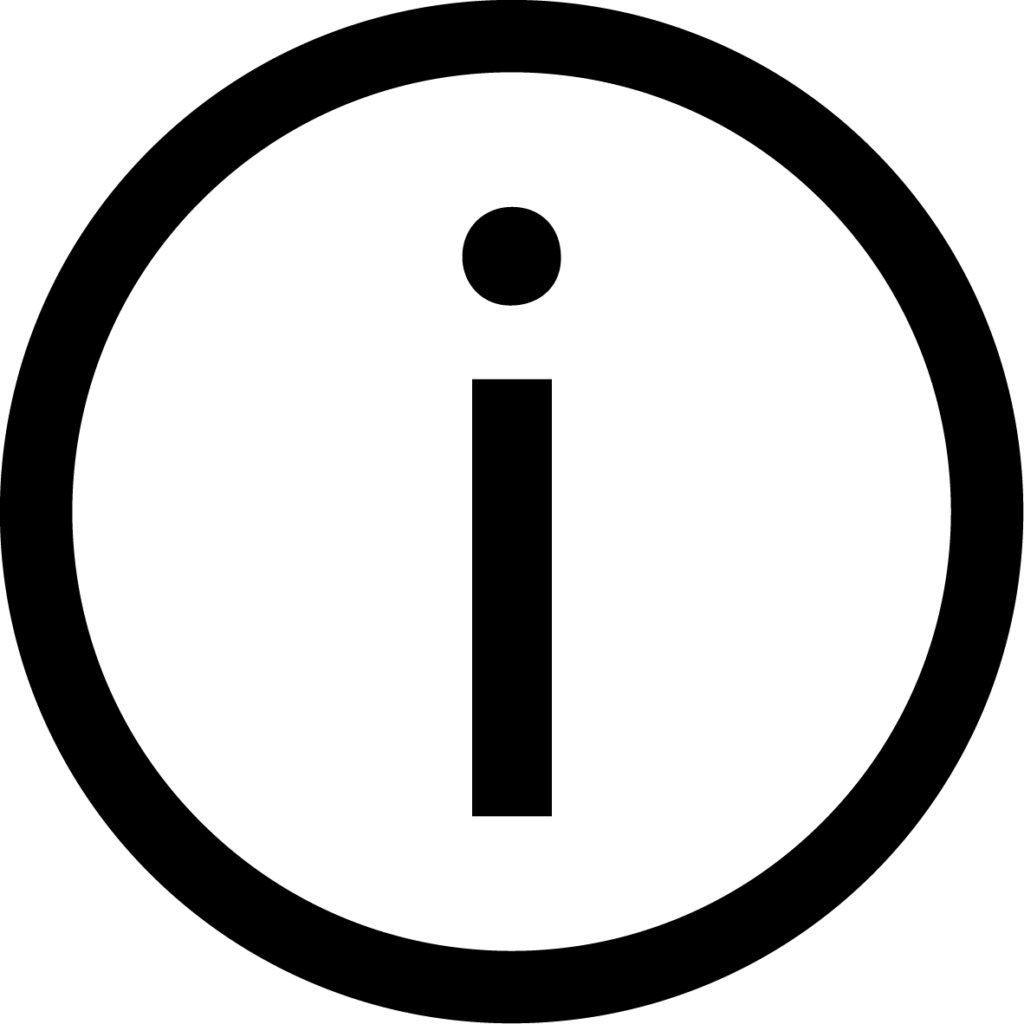
Neue Nachhaltigkeitsinitiative AVE –
was steckt dahinter?
Die AVE Allianz für Verantwortungsvolle Esskultur widmet sich der nachhaltigen Ernährungstransformation in der Gemeinschaftsgastronomie: durch konkrete Ziele und praktische Kollaboration. Mehr dazu lesen Sie hier.
Quelle: B&L MedienGesellschaft