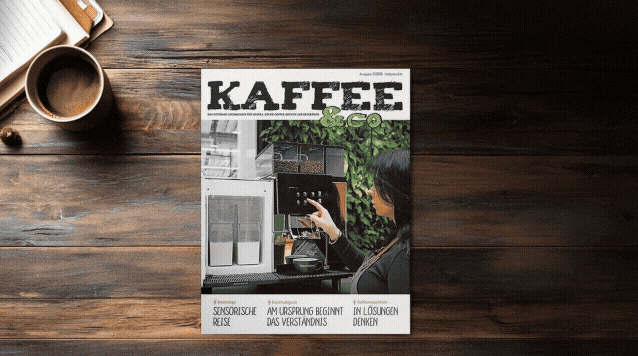Noch immer haben sich Mehrwegbehältnisse für Speisen und Getränke zum Mitnehmen in der Gastronomie nicht wirklich durchgesetzt. Mit ausschlaggebend ist die Vielfalt der Mehrwegsysteme, die sich nur bei ausgewählten Partnern statt in einem öffentlichen Kreislauf wieder zurückgeben lassen.
Ein Poolsystem, wie man es z. B. von den Obst-, Gemüse- sowie Fleischkisten in Profiküchen und Metzgereien kennt, könnte hier Abhilfe schaffen.
„Die Gemeinschaftsgastronomie ist ebenso von der Mehrwegangebotspflicht betroffen wie die freie Gastronomie. Seit dem 22. Januar ist der Ansatz der Tübinger Verpackungssteuer rechtssicher. Auch GV-Betriebe in anderen Städten, gerade die Einführung einer Verpackungssteuer prüfen, könnten davon betroffen werden und brauchen gute Mehrweglösungen.“
Dr. Robert Reiche, Conet Solutions
Pilotprojekt Mehrweg Modell Stadt
Das dachten sich auch die Initiatoren der Initiative Reusable To-Go. Und für ihre Idee konnten sie schnell ein wahres Kompetenznetzwerk an Unterstützern gewinnen:
- von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die das Ganze finanzierte,
- über die Verbände Pro Mehrweg
- und Dehoga Bundesverband,
- den Getränkefachgroßhandel bis hin zu den
- Landesumweltministerien in Hessen und in Rheinland-Pfalz uvm.

Die Idee mündete schließlich im Pilotprojekt „Mehrweg Modell Stadt“.
Im Rahmen dessen wurde zwischen August 2023 und August 2024 in Wiesbaden und Mainz ein System zur anbieterunabhängigen Rücknahme von To-go-Mehrwegbehältern aufgebaut und getestet.
Das Interessante:
Für die Durchführung konnten fast ausschließlich bestehende Infrastrukturen und IT-Lösungen genutzt werden.
Als Spüldienstleister kam beispielsweise ein GV-Betrieb zum Zuge, der so seinen Spülbereich besser auslasten konnte. Folglich könnte von einem bundesweiten Rollout der Idee auch die Gemeinschaftsgastronomie profitieren.
Nachgefragt bei: Robert Reiche

„Im Rahmen des Projekts Mehrweg Modell Stadt haben wir ein lokales Netzwerk geknüpft, bestehend aus Rücklogistik, Reinigungsdiensten und einem Abrechnungssystem. Dank des Settings und der Größenordnung lassen sich daraus Aussagen und Erkenntnisse für einen bundesweiten Rollout ableiten.“
Dr. Robert Reiche, Conet Solutions
Mehr dazu hat der Projektleiter Dr. Robert Reiche, Managing Consultant Data Analytics & Circular Economy bei Conet Solutions, der Redaktion GVMANAGER berichtet. Von Euro Pool System kommend, machte sich der Lebensmitteltechnologe und Mehrwegexperte an die Transformation in Richtung Mehrweg-to-go.
Herr Reiche, würden Sie das Projekt Mehrweg Modell Stadt als erfolgreich einstufen?
Auf jeden Fall! Wir haben es geschafft, auf Grundlage bestehender Infrastrukturen und Lösungen ein System zur anbieterunabhängigen Rücknahme von To-go-Mehrweg-Behältern in Betrieben und öffentlichen Automaten aufzubauen und erfolgreich zu testen. Dafür haben wir ein lokales Netzwerk geknüpft, bestehend aus Rücklogistik, Reinigungsdiensten und einem Abrechnungssystem. Dank des Settings und der Größenordnung lassen sich daraus Aussagen und Erkenntnisse für einen bundesweiten Rollout ableiten.
Zudem haben wir durch das Projekt und vor allem begleitende Kommunikationsmaßnahmen die Mehrwegnutzung fördern können.
Sie haben sich im Praxistest auf Mehrwegbecher beschränkt und Bowls außen vor gelassen – warum?
Diese Entscheidung wurde aus hygienischen Gründen zusammen mit der Arbeitsgruppe Lebensmittelsicherheit und Food Defense bei ENFIT gefällt. Denn das Lebensmittelhygienerisiko bei der unkontrollierten Verbreitung von Bowls mit allen möglichen Speiseresten ist ein großes Thema. Außerdem sind die Pfandwerte von Bowls sehr unterschiedlich, was eine weitere Hürde darstellte. Bei den Bechern dagegen konnten wir durchweg mit einem einheitlichen Pfand von 1 Euro arbeiten bzw. haben uns zunächst auf solche Systeme beschränkt.
Sie haben gerade ENFIT angesprochen. Wie kam es zu dem enormen Kompetenznetzwerk hinter dem Pilotprojekt?
Wir haben das gesamte Ökosystem in den Blick genommen, also nicht nur die Gastronomie und die Konsumenten, sondern auch Logistik und Reinigung sowie Abrechnung.
Dabei war es wichtig, die entsprechenden Experten mit ins Boot zu holen. Und durch das eigene Netzwerk der Experten hat sich das schnell multipliziert. Sogar Politik- und Wirtschaftsverbände, die normalerweise unterschiedliche Standpunkte vertreten, haben an einem Strang gezogen.
Inwiefern ist das Projekt auch für die Gemeinschaftsgastronomie relevant?
Die Gemeinschaftsgastronomie ist ebenso von der Mehrwegangebotspflicht betroffen wie die freie Gastronomie. Seit dem 22. Januar ist der Ansatz der Tübinger Verpackungssteuer rechtssicher. Auch GV-Betriebe in anderen Städten, gerade die Einführung einer Verpackungssteuer prüfen, könnten davon betroffen werden und brauchen gute Mehrweglösungen.
Betriebe haben die Wahl zwischen einem eigenen System oder können sich einem Mehrweganbieter wie beispielsweise FairCup, Recup oder Sykell anschließen. Während dies keine Investitionen erfordert, ist es dennoch eine Herausforderung die Verfügbarkeit der Mehrwegbehältnisse zu planen. Ein offenes lokales Poolsystem könnte Dienstleistung mit regelmäßigem Nachschub könnte das Problem lösen.
Dabei könnte die Großküche selbst eine zentrale Rolle in der gesamten Infrastruktur spielen – als Reinigungsdienstleister für die Mehrwegbehältnisse; ein zusätzliches Geschäftsfeld, das die meist kaum ausgelasteten Spülbereiche besser nutzen könnte. Selbst wenn Geschirr von extern in den GV-Betrieb kommt, stellt das aus hygienischer Sicht kein Problem, da die Spültechnik moderne Standards erfüllt und hohe Keimzahlen reduzieren kann. Einen Leitfaden dafür wird künftig die neue DIN SPEC 91510 fürs gewerbliche Spülen von Mehrweggeschirr geben (Anforderungen an die hygienische Aufbereitung und Wiederbereitstellung von Kunststoff-Mehrwegverpackungen), die im April 2025 veröffentlicht wurde.
Welche Rolle spielen die Kommunen bei einem derartigen Poolsystem?
Einige Städte erwägen, eine Einwegverpackungssteuer einzuführen. Da unser Projekt gezeigt hat, dass 95 Prozent der Mehrwegbecher in einem Poolsystem im näheren Umkreis verbleiben, bietet es sich an, parallel die lokalen Mehrwegkreisläufe zu stärken und eine Infrastruktur aufzubauen, die Betriebe gleichzeitig entlastet. Das ist gar nicht so aufwändig, da großteils etablierte Strukturen genutzt werden, wie wir im Pilotprojekt gezeigt haben.
Wie sieht der Ablauf konkret aus und welche bestehenden Strukturen werden genutzt?

- Dem Gastro-Betrieb werden die benötigten Becher in einer Mehrweg-Transportkiste geliefert. Diese dient auch dazu, die retournierten, verschmutzten Becher zu sammeln. Sie wird verschlossen und verplombt, um Auslaufen und Kontamination, z. B. mit Ungeziefer, zu verhindern.
- Dann werden sie vom Getränke- oder Non-Food-Fachhandel auf den regulären Touren, die etwa sechs- bis achtmal pro Monat stattfinden, mitgenommen.
- Schließlich werden die Kisten im lokalen Netzwerk an gewissen Konsolidierungspunkten, z. B. dem GV-Betrieb alias Spüldienstleister, angeliefert, sortiert, gereinigt und neu kommissioniert.
- Die Abrechnung des Pfandes erfolgt über etablierte Dienstleister, die Pfandabwicklung und Vergütung realisieren. Existierendes Vertrauen zu Dienstleistern ist ein wichtiger Faktor.
Reichen die üblichen Transportzyklen aus, um sicherzustellen, dass die verschmutzten Becher nicht zu lange stehen?
Länger als zwei bis drei Tage dürfen Kaffeereste nicht in einem Mehrwegbecher bleiben, damit das Kaffeeöl keine langfristigen Schäden verursacht. Das haben wir im Netzwerk geprüft und in einem Leitfaden festgelegt. Im Projekt hat es geklappt, das nur mit wenigen zusätzlichen Transporten, beispielsweise nach Feiertagen zu erfüllen.
Welche Standards wurden noch erarbeitet?
Es wurde festgelegt, dass die Rücknahme und Sammlung der verschmutzten Becher in speziellen Kisten erfolgen muss, nicht in Säcken. Diese Kisten sind verschließbar und bieten durch ihre Form Schutz vor Auslaufen und Ungeziefer. Zudem sind die Kisten verplombt, um Diebstahl zu verhindern und die Zuordnung zum Rücknahmebetrieb zu gewährleisten.
Ein weiterer wichtiger Standard ist das Zählprotokoll, welches im Spülbetrieb Anwendung findet und mit dem Abrechnungssystem gekoppelt ist.
Was war die größte Herausforderung bei der Umsetzung des Projekts?
Die Betriebe zur Teilnahme zu motivieren.
Obwohl die Mehrwegangebotspflicht besteht, haben etwa 50 Prozent der Betriebe noch keine Lösung implementiert. Rund 30 Prozent, vor allem Ketten, haben ein eigenes geschlossenes System. Die restlichen 20 Prozent arbeiten mit einem der etablierten Mehrwegsysteme wie Recup oder FairCup.
Wie finanziert sich das Ganze?
Wir haben einen sogenannten Kreislaufbeitrag eingeführt, der verursachungsgerecht auf die Dienstleister im Rückführungssystem aufgeteilt wird.
Das bedeutet, dass der Verbraucher, der einen Coffee-to-go kauft, diesen Kreislaufbeitrag bezahlt. Der Beitrag orientiert sich an den Preisen der beteiligten Dienstleister und kann je nach Stadt variieren. Im Pilotprojekt haben wir mit einem Beitrag von 50 Cent gearbeitet, was aufgrund des geringen Volumens nicht ausreichte. Wir gehen davon aus, dass bei einem Rollout der Beitrag zwischen 20 und 30 Cent liegen wird. Damit wäre das System wettbewerbsfähig im Vergleich zu Einwegbechern, deren Kosten inklusive Entsorgung ebenfalls anfallen.
Und wie wird abgerechnet und nachvollzogen, was woher kommt?
Jeder Gastronomiebetrieb hat seine eigenen Plomben und Nummern, sodass die Mehrwegkisten eindeutig zugeordnet werden können. Im Spülbetrieb wird der Inhalt der Kisten gezählt und an das sogenannte Pfandclearing weitergeleitet, wo die Abrechnung erfolgt. Dieses Verfahren ähnelt bekannten Abwicklungssystemen für Leergut, z. B. dem von Coca-Cola.
Um das Ganze einen Schritt weiter zu standardisieren können die einzelnen Becher mit QR-Code und Seriennummer versehen werden, oder im zweiten Schritt auch mit RFID-Chips.
Welche IT-Infrastrukturen braucht es im Hintergrund?
Ein Mehrwegregister, dass die Unternehmen und Artikel verwaltet, die mitmachen.
Die GEDAT, die Absatzdatenplattform der Getränkeindustrie, soll für die Digitalisierung und Verwaltung des Systems verwendet werden. Sie erfasst bereits jetzt Stammdaten und Lieferbewegungen von über 190.000 Betrieben.
Mehrwegbecher wären dabei nur ein weiterer Artikel, der hinzugefügt wird. Diese Plattform hat den Vorteil, dass sie bereits millionenfach Transaktionen abwickelt, sodass die Akzeptanz bei den Beteiligten groß ist.
Wie soll das Poolsystem künftig koordiniert werden?
Das System muss auf einer sogenannten stakeholder-basierten Governance beruhen, bei der der Aufwand aller beteiligten Interessengruppen fair verteilt wird. Es darf nicht in den Händen einer einzelnen Partei liegen, sondern muss als gemeinschaftliches Projekt gestaltet sein. An dieser Struktur arbeitet die Initiative Reusable-to-go aktuell, um dem Pilotprojekt eine langfristige Perspektive zu geben.
Wie geht es mit dem Projekt weiter?
Wir verabschieden gerade das Regelwerk und die Ablauforganisation und stehen in Gesprächen mit weiteren Städten, die das System bei sich einführen wollen. Zudem erweitern wir unser Netzwerk und haben mit Berry Global, Sielaff und Meiko weitere Partner ins Boot geholt, um das Angebot der Initiative zu stärken. Ziel ist es, aus der aktuellen Übergangsphaseschnell in eine professionelle und skalierbare Lösung überzugehen.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Projekt „Mehrweg Modell Stadt“
- Ablauf: Entwicklung einer Infrastruktur für die Sammlung, den Rücktransport, Reinigung und erneute Auslieferung von To-go-Mehrwegbehältern, die logistischen und hygienischen Anforderungen aller beteiligten Partner des Mehrwegsystems gerecht wird.
Integration dieser Infrastruktur in etablierte Mehrweginfrastrukturen.
Übergreifende digitale Abwicklung. - Projektzeitraum: 2022 bis August 2024, Praxistest von März bis Mai 2024
- Initiator: Initiative Reusable-to-go
- Durchführung: Conet Solutions GmbH und 30 Partnerunternehmen
- Praxispartner: rund 100 Bäckereien, Kaffeeröstereien und Cafés in Wiesbaden und Mainz
- Weitere Beteiligte (Auswahl): Circ Nette Mehrweg, Sykell, HEAG FairCup, Kooky, Cup & More, WASTO-PAC, gastivo, kollex, Getränke Schneider, WIGEM, Trinkkontor der Bitburger Braugruppe, ecoCarrier, Colysis, Muthmedia,
- Beirat: Bundesverband des dt. Getränkefachgroßhandels e.V., Pro Mehrweg e.V., Dehoga Bundesverband, ENFIT e.V., Arbeitskreis Mehrweg
Über Dr. Robert Reiche
Dr. Robert Reiche ist Experte für Circular Economy und Digitalisierung bei der CONET Solutions GmbH und übernahm die Leitung des Projektes. Nach seinem Studium der Lebensmitteltechnologie und Promotion, arbeitete er bei der Euro Pool System als Innovationsmanager und jetzt als Managing Consultant für die CONET.
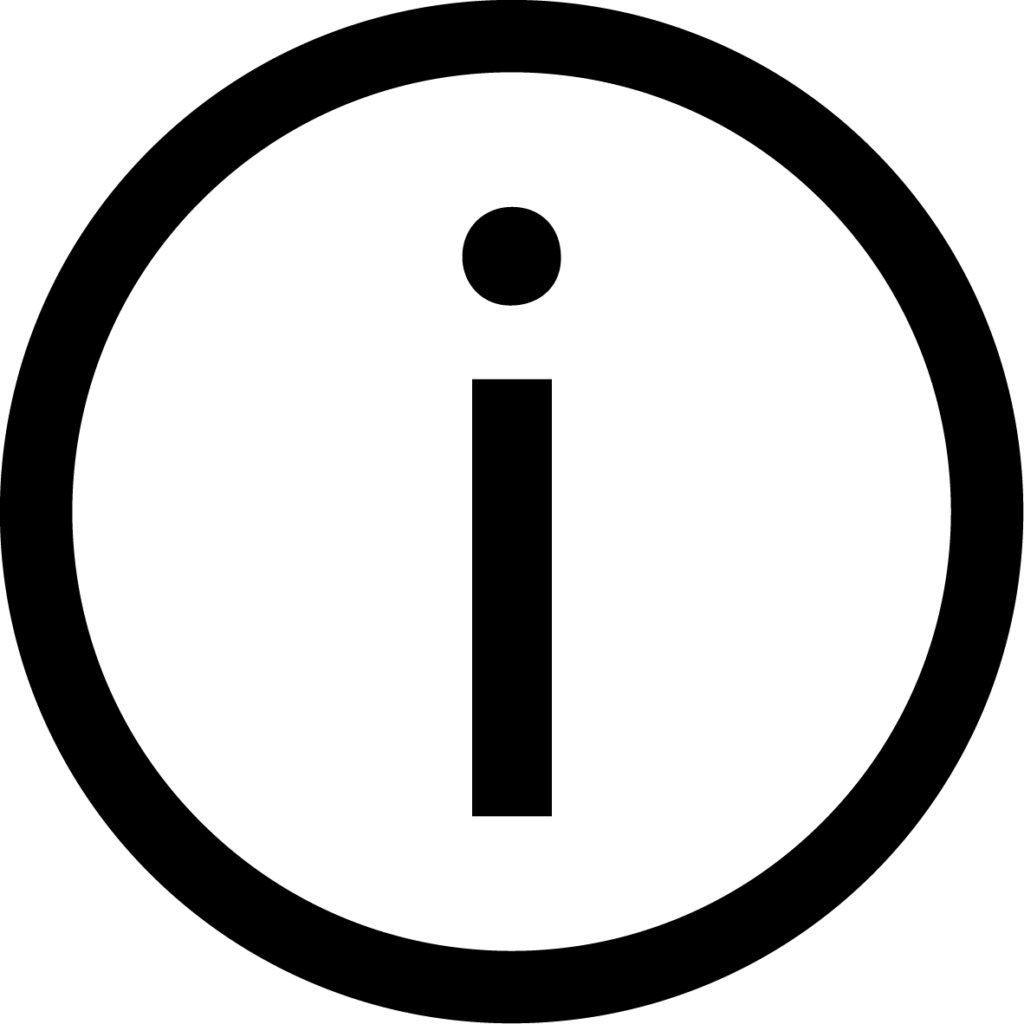
Tipps zur Umsetzung
von Mehrweglösungen
Mehrweg lohnt sich sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich. Doch welche konkreten Maßnahmen helfen bei der Umsetzung im eigenen Betrieb? Hier gibt es Tipps.
Quelle: B&L MedienGesellschaft