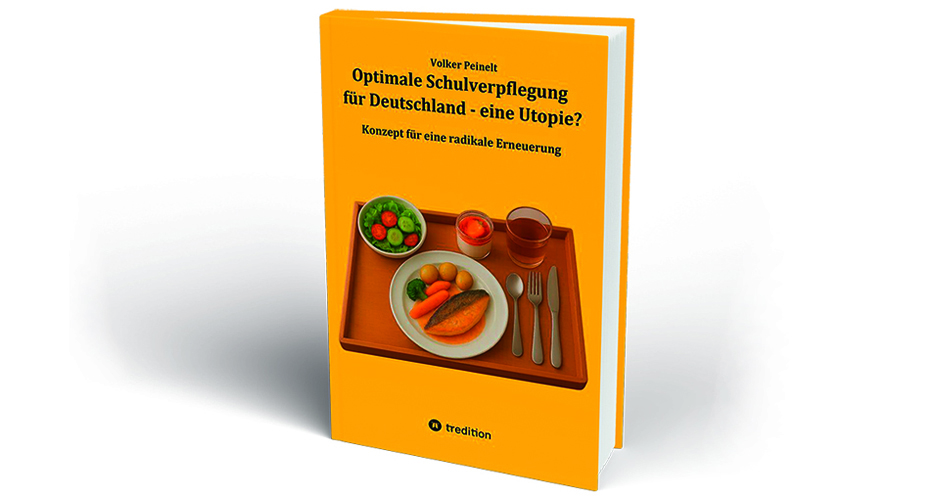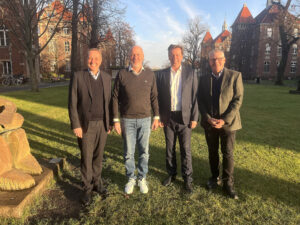Schaffen wir es in Deutschland, die Bremsklötze zu beseitigen, die einer sehr guten Schulverpflegung im Wege stehen? Oder bleibt alles eine Utopie? Diese Frage wirft Prof. Dr. em. Volker Peinelt in seinem neuen Buch auf. Hinter „Optimale Schulverpflegung für Deutschland – eine Utopie? Konzept für eine radikale Erneuerung“ verbirgt sich eine komplett überarbeitete, dritte Auflage seiner Überlegungen zur Schulverpflegung in Deutschland.
Das Buch ist erhältlich als Soft- oder Hardcover und E-Book zu Preisen zwischen 9,99 Euro und 25,99 Euro.
Knackpunkt politischer Wille
Die Analysen des rund 500-seitigen Werks gipfeln in einem „7-Punkte-Konzept“, wie sich die deutsche Schulverpflegung radikal verbessern ließe. Der Knackpunkt: ohne politischen Willen geht das nicht. Grundvoraussetzung für die Anwendung von Peinelts Konzept wäre die Zuständigkeit des Bundes und eine Nationale Schulverpflegungs-Verordnung.
Inhaltlich geht es u. a. um:
- Erfolgsmodell Japan als Blaupause für Deutschland?
- Update Ist-Situation – Analyse aktueller Studien
- Finanzierung und Kosten – kostenloses Schulessen
- Robotik für die Schulverpflegung
- Vergleich von Verpflegungssystemen
- Zertifizierungssysteme
- „7-Punkte-Konzept“
Mehr zur Neuauflage des Buchs, zu seinem 7-Punkte-Konzept und zur abschließenden Frage, ob eine radikale Erneuerung realistisch oder doch utopisch ist, hat Prof. Dr. Volker Peinelt der Redaktion Schulverpflegung exklusiv im Interview berichtet.
Nachgefragt bei: Volker Peinelt, Autor

„Stand heute muss man eine optimale Schulverpflegung als eine Utopie bezeichnen. Es hängt von den Verantwortlichen ab, ob sie den Mut haben, alte Zöpfe abzuschneiden und das Wagnis eines neuen Konzepts einzugehen. Möglich wäre es. Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif dafür.“
Prof. Dr. em. Volker Peinelt
Herr Peinelt, warum lohnt es sich, die neueste Auflage Ihres Buchs zu kaufen? Was ist gegenüber den vorigen Auflagen neu?
Die nunmehr dritte Auflage meines Buches ist sieben Jahre nach dem Erscheinen der letzten Auflage stark überarbeitet worden. Das betrifft neben dem Titel auch den Inhalt.
- So wurden die Ist-Situation der deutschen Schulverpflegung und die Frage der Umsetzbarkeit der japanischen Verhältnisse für den deutschen Erfolgsweg noch detaillierter beschrieben.
- Es sind ferner einige neue Kapitel hinzugekommen. So werden z. B. die Einsatzmöglichkeiten des Kochroboters bewertet.
- Auf Kongressen, Tagungen und Symposien sowie in diversen Fachzeitschriften wird durch Berichte und Interviews viel über den Stand der Schulverpflegung publiziert. Ich bin auf einige dieser Publikationen in der Neuauflage des Buches näher eingegangen, z.B. auf die Ergebnisse einer großen BMEL-Studie.
- Ferner werden weitere Studien und deren Aussagekraft behandelt. Damit soll geprüft werden, ob wir bei der Schulverpflegung im letzten Jahrzehnt weitergekommen sind.
Sie analysieren auch die Rolle bundesweiter Organisationen in puncto Schulverpflegung…
Korrekt. Ich überprüfe verschiedene Instrumente, mit denen Fortschritte erzielt werden sollen. So wird die Rolle der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) – insbesondere der Qualitätsstandard, des „Bundeszentrums für Kita- und Schulverpflegung“ und der „Vernetzungsstellen Schulverpflegung“ in Bezug auf wünschenswerte Aktivitäten untersucht.
Diese Analysen werden in zwei späteren Kapiteln des Buches wieder aufgegriffen, wenn es darum geht, die Hinderungsgründe für die Umsetzung der optimalen Schulverpflegung aufzuzeigen.
Es geht darum, Empfehlungen auszusprechen, welche neuen und effektiveren Aufgaben die o.g. Organisationen im Rahmen des Konzepts der optimalen Schulverpflegung übernehmen sollten.
Sie widmen sich auch einer gründlichen Analyse der bestehenden Verpflegungssituation…
Die Ist-Situation wird ergänzt um aktuelle Berichte, in denen gezeigt wird, wie sich die deutsche Schulverpflegung im letzten Jahrzehnt entwickelt hat. Hat es neue Zielsetzungen gegeben? Werden die Forderungen des 7-Punkte-Konzepts, dem Kernstück der optimalen Schulverpflegung laut meinem Buch, wenigstens ansatzweise erfüllt oder ist vielmehr alles beim Alten geblieben?
Neben der flächendeckenden Einführung des „Frischkostsystems“ wird auch geprüft, ob wenigstens eine Warmverpflegung möglich ist, die hohe Qualitätsansprüche erfüllen kann, wie das in Japan gelingt.
Erst wenn man diese Analyse vollständig verstanden hat, wird man der Erkenntnis zustimmen können – ja müssen, dass es bei uns mit der Schulverpflegung so nicht weitergehen darf und eine Alternative gefunden werden muss. Daher ist dieses Kapitel für das Verständnis des neuen Konzepts wichtig. Dann wird man die Forderungen auch gar nicht mehr so radikal finden, wie sie bei vordergründiger Betrachtung erscheinen mögen. Radikal ist das Konzept für die Erneuerung der Schulverpflegung nur dem, der in den alten Vorstellungen und Gewohnheiten verharrt.
Gibt es neue Ansätze in puncto Finanzierung der Schulessen?
Hier werden die alten Zahlen auf den neuesten Stand gebracht, um in Kombination mit neueren Daten über die Schülerzahl die Kosten für eine Schulverpflegung für alle abzuleiten.
Erfahrungsgemäß verursachen temperaturentkoppelte Systeme nur moderate Kosten. So könnten die Kosten für die Schulverpflegung trotz hoher Schulden und enormer Investitionen in Deutschland leicht getragen werden.
Zudem zeige ich einige Finanzquellen auf, die man so noch nicht auf dem Schirm hatte.
Sie werden nicht müde, zu betonen, dass der politische Wille für den Erfolg der Schulverpflegung entscheidend ist…
Die Schulverpflegung für ganz Deutschland kostet beim richtigen System nur Peanuts. Und das Geld ist „im Überfluss“ vorhanden, wenn man den Blick auf bisher ignorierte Ressourcen richtet. Natürlich hat das auch etwas mit der Priorität zu tun, welche die Politik der Schulverpflegung zuweist. Davon leitet ich ab, ob das Mittagessen für Schüler kostenlos sein sollte oder nicht – deutlich ausführlicher als bisher.
An wen richten Sie sich inhaltlich?
- Politiker auf allen Ebenen,
- Küchenleiter, Köche, Küchenfachkräfte, Cateringunternehmen,
- Fachplaner und Architekten,
- Lehrer, Eltern, gerne auch Schüler.
Letztere beiden Gruppen v. a. dann, wenn sie im Mensabeirat tätig sind. Natürlich richtet sich das Buch inhaltlich auch an die Fachkollegen und Fachinstitute, wie die DGE, BZKS oder die Vernetzungsstellen.
Es sind im Grunde alle angesprochen, die mitentscheiden, beraten oder Verantwortung tragen. Da die Schulverpflegung Ländersache ist, sollten es primär Landespolitiker, aber auch Kommunalpolitiker lesen. Da im Buch aber auch eine bundespolitische Neuerung verlangt wird, würden auch Bundespolitiker das Buch mit Gewinn zur Hand nahmen.
Sie thematisieren das kostenlose Schulessen – zu welchem Schluss kommen Sie?
Bei der gesamten Schulverpflegung in Deutschland handelt es sich um einen vergleichsweise kleinen Betrag. In meinem Buch wurden verschiedene Ausgaben des Staates dazu in Beziehung gesetzt, und zwar Ausgaben, die im Grunde gestrichen oder stark reduziert werden sollten. Hinzu kommen Steuerverluste, wobei ich „nur“ die kriminelle Hinterziehung von Steuern anspreche und die unrühmliche Rolle des Staates hierbei.
Denn dieser hat dazu beigetragen, dass so hohe Steuerausfälle Jahr für Jahr entstehen. Das sind die Ergebnisse einer Untersuchung des deutschen Bundestags. Nimmt man die beiden größten Posten dieser Steuerausfälle, so kommt ein Betrag zusammen, der 100-mal größer ist als die Gesamtkosten der Schulverpflegung. In diesem Betrag sind auch die Kosten für eine strenge Zertifizierung enthalten, die eine hohe Qualität garantieren würde.
Sie versprechen ein Konzept für eine radikale Erneuerung. Was sind Ihre Top 5 Stellschrauben?
Ich habe meine Vorschläge für die radikale Erneuerung der deutschen Schulverpflegung in einem „7-Punkte-Konzept“ zum Ausdruck gebracht.
Grundvoraussetzung für die Anwendung dieses Konzepts ist die Zuständigkeit des Bundes. Er müsste eine Nationale Schulverpflegungs-Verordnung (NSVVO) erlassen und die Neuverteilung der Finanzen regeln. Das wären schon zwei Punkte des Konzepts. Hierfür ist eine Grundgesetzänderung erforderlich. Zweifellos eine harte Nuss, aber bei gutem Willen machbar. Andere Länder haben das auch geschafft. In dieser neuen NSVVO sind noch folgende fünf Top-Punkte zu regeln:
- 1. Strenges Auswahlverfahren für die Bewerber. Oberflächliche Entscheidungen durch Probeessen und den Preis sind dann nicht mehr akzeptabel.
- 2. Bevorzugung der am besten geeigneten Verpflegungssysteme (Temperaturentkopplung). Andere Systeme werden nicht verboten, wenn ihre Qualität und Funktionalität durch strenge Zertifizierungen bewiesen wurden.
- 3. Umfassendes und professionelles QM-System, das alle wesentlichen Bereiche abdeckt und sich nicht nur auf ernährungsphysiologische Aspekte und die Qualität von Speisenplänen beschränkt. Hierzu gehören die Themen Nachhaltigkeit und sensorische Qualität genauso wie die Erfüllung von Anforderungen des Arbeitsschutzes oder Vorgaben für Verpflegungssysteme.
- 4. Einführung der Zertifizierungspflicht, und zwar mit einem strengen Konzept (Basis: Hochschule Niederrhein). Jede Schule und jede Zentralküche sind zu zertifizieren. Dies mag zwar aufwändig erscheinen. Wenn aber die anfänglichen Fehler erst einmal ausgemerzt sind, ist der Aufwand nicht mehr hoch.
- 5. Ernährungsunterricht und Verzehrpflicht. Nur bei einer strengen Zertifizierung ist von einer guten sensorischen Qualität auszugehen, so dass eine Verzehrpflicht akzeptiert werden kann. Wird die Schulverpflegung zu einer inneren Angelegenheit der Schule, was durch den Unterricht problemlos möglich wäre, ergibt sich die Verzehrpflicht von alleine.
Alle diese Punkte wurden im Buch ausführlich begründet und erläutert. Die Vorteile bei einer bundesweiten Einführung des „7-Punkte-Konzepts“ sind unübersehbar. Das System optimiert die Schulverpflegung automatisch, weil Schwachstellen bei Audits erkannt und schnellstmöglich beseitigt werden müssen. Ein Eingreifen von außen wäre dann weitgehend überflüssig.
Stichwort Utopie – wie realistisch ist Ihr 7-Punkte-Konzept?
Radikal ist das Konzept, weil die rechtlichen Voraussetzungen nur schwer zu schaffen sind.
Auch die fünf Einzelmaßnahmen werden auf Gegenwehr stoßen.
Es ist davon auszugehen, dass zunächst einmal viele Cateringunternehmen bei den Prüfungen durchfallen werden, so meine jahrelange Erfahrung mit Zertifizierungen. Es bleiben nur die qualifizierten Unternehmen übrig. Und das wollen wir doch auch! Erneute Prüfungen sind natürlich möglich. Es wird also ein ordentliches Stück Arbeit nötig sein, um die Kritiker zu überzeugen.
Wer könnte als Multiplikator unterstützen?
Die Politiker könnten leichter überzeugt werden, das Konzept umzusetzen, wenn die wissenschaftlichen Fachinstitutionen von der Wirksamkeit des neuen Konzepts zu überzeugen sind. Diese Institutionen sind es, von denen die Politik beraten wird.
Ich bin mir im Klaren darüber, dass dies alles hohe Hürden sind. Die DGE hat gerade ein neues Prüfkonzept veröffentlicht, den VerpflegungsCheck, von dem sie sich nicht so leicht verabschieden wird. Allerdings hat es erhebliche Schwachstellen, weshalb es gut wäre, dieses Konzept zugunsten meines Entwurfs optimaler Schulverpflegung aufzugeben.
Sie erwähnten die Schwachstellen des neuen VerpflegungsCheck der DGE. Können Sie einige Kritikpunkte kurz erläutern?
Ich bin in drei Einzelkapiteln des Buchs auf den fragwürdigen Ansatz der Überprüfung von Schulen und Cateringfirmen im neuen VerpflegungsCheck eingegangen. Neuerdings können keine Betriebe, ob Kita, Schule oder Cateringbetrieb, mehr durchfallen. Vielmehr werden alle ausgezeichnet, auch dann, wenn sie sehr schlechte Ergebnisse erzielt haben. Dies stellt eine Perversion des Prüfungsgedankens dar, denn eine Prüfung wird ja deshalb gemacht, weil man feststellen will, ob der Prüfling die Mindestanforderungen erfüllt, damit er für eine Tätigkeit qualifiziert ist. Statt schlechte Betriebe durchfallen zu lassen, werden sie ausgezeichnet.
Abgesehen von dem befremdlichen Prüfungsansatz kann es leicht vorkommen, dass Betriebe gravierende Schwachstellen aufweisen, die sogar gesundheitsschädlich sein können, z. B. ein fehlendes HACCP-Konzept. Daher müsste die Prüfung mit KO-Kriterien arbeiten, die also zwingend erfüllt werden müssen. Solche Kriterien gibt es aber nicht.
Diese und viele andere Aspekte der neuen Prüfung wurden im neuen Buch näher untersucht.
Wie sehen Sie aktuell dem ersten Stichtag des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) entgegen? Was sind die größten Herausforderungen?
Auch wenn man bedenkt, dass die Anwendung des Rechts auf ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen sukzessive erfolgt, so ist Deutschland doch bei weitem nicht gerüstet, um die hierfür notwendige Schulverpflegung auf einem hohen Qualitätslevel zu realisieren. Das ist sehr bedauerlich und ärgerlich, war das Gesetz doch schon im Jahr 2021 verabschiedet worden. Doch beim Stand der deutschen Schulverpflegung, wie sie sich seit Jahrzehnten präsentiert, ist ein solcher Vorlauf viel zu kurz. Welche vorbereitenden Maßnahmen mit welchem Zeithorizont erforderlich sein dürften, wurde in der Neuauflage des Buches ebenfalls thematisiert. Fünf Jahre reichen da nicht aus.
Ein Problem des Föderalismus?
Durch die föderale Zuständigkeit bei der Schulverpflegung konnte man nichts anderes erwarten. Auch durch das grundgesetzlich verbriefte Recht der Kommunen, Einzelheiten diesbezüglich regeln zu dürfen, kann eine zentrale Vorgabe eines rationalen, effizienten und einheitlichen Systems nicht gemacht werden. Man könnte auch sagen, dass sich Deutschland selbst Fesseln angelegt hat, sodass die Schulverpflegung nur in einem chaotischen Durchwursteln möglich ist. Und genau das ist es, was wir seit Jahren beobachten können – von Ausnahmen abgesehen.
Ihr Fazit: ist optimale Schulverpflegung realistisch oder utopisch?
Stand heute muss man eine optimale Schulverpflegung als eine Utopie bezeichnen. Es hängt von den Verantwortlichen ab, ob sie den Mut haben, alte Zöpfe abzuschneiden und das Wagnis eines neuen Konzepts einzugehen. Möglich wäre es. Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif dafür.
Was passiert, wenn wir im Wesentlichen so weitermachen wie bisher?
Dies hätte erhebliche Nachteile für Deutschland und würde die Schulverpflegung dauerhaft auf einem niedrigen Niveau fixieren. Ohne eine gute Schulverpflegung würden nicht zuletzt die Bildungschancen der Schüler verschlechtert – mit den leicht absehbaren Konsequenzen für den Wissenschaftsstandort Deutschland.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Krisensichere Kita- und Schulverpflegung
Blackout, IT-Ausfälle, Cyberkriminalität oder Grippewelle: Es gibt viele Risiken, die die Versorgungssicherheit von Kita- und Schulessen potenziell gefährden können. Doch zu selten sind sich Akteure dessen bewusst und vorbereitet. Abhilfe soll ein Digitaler Werkzeugkasten des BMLEH schaffen. Was enthält dieser konkret?
Quelle: B&L MedienGesellschaft