Die AVE – Allianz für verantwortungsvolle Esskultur hat Anfang 2025 ihre Arbeit aufgenommen. Iniatiatorin und Projektleiterin Marisa Hübner betont den hohen Stellenwert der Initiative für mehr Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsgastronomie: „Es gibt schon einige Zertifizierungen und auch wissenschaftliche Projekte, aber nichts ausgehend von der Praxis.“
Die Intention: Einerseits vernetzen und herausstellen, was in Deutschland in puncto nachhaltige Gemeinschaftsgastronomie bereits passiert und damit Leuchttürmen eine Bühne bieten. Andererseits dazu animieren, eine verantwortungsvolle Esskultur mitzugestalten und voneinander zu lernen.
Im folgenden Beitrag geht es darum:
- Wer sind die Gründungsmitglieder der Allianz für Verantwortungsvolle Esskultur und wie kann man Mitglied werden?
- Warum sollte man sich der AVE als Mitglied anschließen und damit mit einem Mitbewerber auf eine Ebene begeben und vielleicht gar über Interna austauschen?
- Welche sechs Ziele hat sich die AVE gesetzt und warum?
- Warum wird die Zielerreichung wissenschaftlich begleitet?
Wer steckt hinter der AVE?
„In Deutschland sind bereits viele Gemeinschaftsgastronomen nachhaltig unterwegs, aber in der Regel weiß keiner so genau, wie weit er schon ist und wo er hin will. Messbare Ziele könnten das ändern.“
Marisa Hübner, Projektleiterin AVE
Initiatorin und Projektleiterin der neuen Allianz ist Marisa Hübner von der Mission Farm-Food-Climate innerhalb von Project Together.
Ihr Team und sie haben nachhaltig engagierte GV-Betriebe im Rahmen einer gemeinsamen Reise nach Kopenhagen zusammengebracht und die an einer engeren Kooperation Interessierten zwei Jahre bis zur schließlichen Gründung der Allianz für Verantwortungsvolle Esskultur begleitet.
Vier Partner aus verschiedenen GV-Teilbereichen haben die AVE innerhalb der gemeinnützigen Organisation ProjectTogether mitbegründet:
Hoher Praxisbezug als Abgrenzungsmerkmal
Die Besonderheit der AVE ist der sehr praxisnahe, kollaborative Ansatz:
„Nach dem Motto aus der Praxis für die Praxis tauschen wir uns überbetrieblich zu allen Bereichen aus – z. B. über Einkauf, Speiseplanung, Dokumentation, Mitarbeiterführung und Kundeninformation“, veranschaulicht Änne Fresen vom Gründungsmitglied Ina.Kinder.Garten und nennt konkrete Fragestellungen, wie: Welche Rezepte sind Renner – welche Penner? Wie können Überproduktionen vermieden oder sinnvoll weiterverwendet werden?
Derartige Themen werden in Quartalsmeetings der Mitglieder ausgelotet. Zur Lösung der Herausforderungen sind neben dem sogenannten Peer-to-Peer-Austausch untereinander auch systemische Kollaborationsprojekte geplant. „Dabei versuchen wir im Grunde alle zusammenzubringen, die bereits an diesem Thema arbeiten, sei es Organisationen, Institutionen oder Personen, Akteure aus Wissenschaft, Verwaltung oder Praxis“, konkretisiert Marisa Hübner.
Um das viele Wissen, das in Deutschland bereits frei verfügbar ist, so zu bündeln und aufzuarbeiten, dass es auch für Großverpfleger umsetzbar wird, plant die AVE Formate wie Großküchenhospitationen o.ä.
Nachgefragt bei den AVE-Mitgliedern

Was halten Sie von dem kollaborativen Ansatz – über Teilsegmente der Gemeinschaftsgastronomie hinweg – und wie haben Sie bislang ggf. partizipiert?

„Nach dem Motto aus der Praxis für die Praxis tauschen wir uns überbetrieblich zu allen Bereichen aus – zum Beispiel über Einkauf, Speiseplanung, Dokumentation. Mitarbeiterführung und Kundeninformation. Konkrete Beispiele: Welche Rezepte sind Renner – welche Penner? Wie können Überproduktionen vermieden oder sinnvoll weiterverwendet werden?“
Änne Fresen, Ina.Kinder.Garten

„Der kollaborative Ansatz ist einzigartig, weil er die verschiedenen Teilsegmente der Gemeinschaftsgastronomie – von Betriebsrestaurants über Kliniken und Seniorenheime bis hin zu Schul- und Hochschulverpflegung – zusammenbringt.
Vorangebracht hat uns dieser bereits bei unserer Initiative We Love Green, eine pflanzenbasierte Menülinie, die auf frische, saisonale und regionale Zutaten setzt. Durch den Erfahrungsaustausch mit anderen AVE-Mitgliedern konnten wir wertvolle Erkenntnisse über die Optimierung von Rezepturen, die Akzeptanz pflanzlicher Speisen und nachhaltige Beschaffungsstrategien gewinnen.“
Thorsten Greth, Klüh Catering

„Der kollaborative Ansatz ist für uns äußerst wertvoll. Er fördert Synergien und ermöglicht innovative Lösungsansätze. Angesichts der branchenweiten Herausforderungen wie Fachkräftemangel und Kostendruck sind neue Wege und der offene Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg essenziell.“
Daniela Kirsch, Rebional

„In der AVE kommen aktuell ganz unterschiedliche Unternehmen der Gemeinschaftsgastronomie zusammen. Trotz dieser Verschiedenheit, die sich auch in differenten Zielgruppen und deren Bedürfnissen bemerkbar macht, stehen wir oftmals vor denselben Fragestellungen und Herausforderungen. Gemeinsam, statt einsam – indem wir innerhalb der Allianz unser Wissen bündeln, Erfahrungen teilen und gemeinsam neue Ansätze erarbeiten, können wir etwas bewegen. In dieser Kollaboration sehen wir Chancen für die notwendige Weiterentwicklung hin zu einer zukunftsfähigen Gemeinschaftsverpflegung.“
Moritz Mack, Mercedes-Benz Gastronomie
Sechs konkrete, messbare Ziele bis 2030
In gemeinsamen Workshops, wissenschaftlich unterstützt von Regionalwert Research, haben sich die Gründungsmitglieder der AVE sechs klare, messbare Ziele gesetzt, welche sie bis 2030 erreichen wollen.
Die Messbarkeit wird garantiert durch ein multidimensionales Indikatorensystem und die wissenschaftliche Begleitung durch Regionalwert Research.


Die Ziele der AVE im Überblick
- Pflanzliche Lebensmittel: 75 % Monetärer Anteil des Einkaufs pflanzlicher Produkte im Verhältnis zum Gesamteinkauf
- Ökologische Lebensmittel: 40 % Monetärer Anteil Einkauf an Bio-Produkten (EU-Bio-Siegel) im Verhältnis zum Gesamteinkauf
- Faire Beziehungen: 90 % der Zutaten Kakao, Kaffee und Bananen wurden fair gehandelt oder anderweitig nachweislich ohne Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen eingekauft
- Lebensmittelabfälle: Ein Messsystem zur Reduktion der Lebensmittelabfälle ist etabliert. Im Idealfall besteht zusätzlich eine externe Zertifizierung z.B. durch die Kompetenzstelle Außer-Haus-Verpflegung (KAHV)
- Saisonalität/Regionalität: Die Menügestaltung orientiert sich am Saisonkalender. Der genaue Zielwert für Regionalität ist aktuell in der Entwicklung.
- Gästezufriedenheit: Tischgäste werden über die Beschaffungs- und Nachhaltigkeitsstrategie der Speisen informiert. Tischgäste können die Essensqualität bewerten.
Nachgefragt bei: Marisa Hübner, Projektleiterin AVE
Marisa Hübner hat der Redaktion GVMANAGER mehr über das Indikatorensystem und die Mitgliedschaft bei der Allianz für Verantwortungsvolle Esskultur verraten:

„Die aktuellen Herausforderungen kann kein Einzelner lösen. Wir müssen uns zusammenschließen und unser Know-how bündeln, um das Thema nachhaltige, gesunde Verpflegung voranbringen zu können. Man kann sich in seiner Nachhaltigkeitsstrategie in vielen Kleinigkeiten unterscheiden – und nicht zuletzt sind viele grundlegende Fragestellungen schlicht wettbewerbsunkritisch.“
Warum sollte man sich der AVE anschließen und damit mit einem Mitbewerber auf eine Ebene begeben und vielleicht gar über Interna austauschen?
Über Sektoren hinweg miteinander zu sprechen, ist ungewohnt, aber seit jeher Ansatz von Project Together, die mit hinter der AVE stehen. Die aktuellen Herausforderungen kann kein Einzelner lösen. Wir müssen uns zusammenschließen und unser Know-how bündeln, um das Thema nachhaltige, gesunde Verpflegung voranbringen zu können. Man kann sich in seiner Nachhaltigkeitsstrategie in vielen Kleinigkeiten unterscheiden – und nicht zuletzt sind viele grundlegende Fragestellungen schlicht wettbewerbsunkritisch. Wir haben über die Sektoren hinweg alle dieselben Herausforderungen, obwohl wir so unterschiedlich sind. Das verbindet.
Es gibt ein Indikatorensystem mit sechs Zielen, darunter drei quantitative. Ist das in Stein gemeißelt?
Das Indikatorensystem ist ein Prototyp, der 2024 aus der Zusammenarbeit von Praktikern unserer Gründungsmitglieder und Regionalwert Research entstanden ist.
Es orientiert sich an der Planetary Health Diet sowie nationalen und internationalen Empfehlungen und Vorbildern. Bei der konkreten Zielfindung wurde das zugleich ins Verhältnis gesetzt mit der Praktikabilität. Anstelle eines starren Rahmenwerkes, soll das Indikatorensystem als Steuerungswerkzeug dienen, das hilft durch die Veränderung zu manövrieren.
Perspektivisch werden wir vielleicht auch noch manches verfeinern, wie den Anteil pflanzlicher Zutaten, um z. B. Diversität und Lebensmittelgruppen besser abzubilden.
Warum gibt es noch keinen Zielwert für den Einsatz regionaler Produkte?
Bei der Regionalität geht es vor allem um die Stärkung der lokalen Wertschöpfungskräfte und Arbeitskraft. Aber was verstehen wir unter regional? Eine Definition gibt es nicht. Und wie sieht eine faire eigene Definition aus in einem Land, in dem gewisse Agrarprodukte gar nicht verfügbar sind? Hinzu kommt, dass es aktuell nicht transparent ist, woher all die Lebensmittel kommen.
Zur Zielerreichung werden monetäre Werte herangezogen, z. B. beim Bio-Anteil und dem Anteil pflanzlicher Lebensmittel. Wäre das Gewicht hier nicht aussagekräftiger und besser vergleichbar?
Das stimmt! In Kopenhagen wurde alles metrisch bemessen, bezogen auf das Gewicht, selbst das Ziel 60 % Saisonalität. Den monetären Anteil zu messen, bringt gewisse Unschärfen mit sich, ist derzeit aber am einfachsten umsetzbare Weg in der Fläche. Die Ziele sind so gesetzt, dass sie möglichst aus dem Warenwirtschaftssystem ausgespielt werden können, was mit den Ausnahmen Foodwaste und Gästezufriedenheit möglich ist.
Allerdings wird einer der nächsten Schritte sein, das Datenmanagement zu vereinfachen und zu optimieren.
In den Niederlanden beispielsweise ist man schon einen Schritt weiter. Da es dort einen Zielwert für den Protein-Split von tierischen und pflanzlichen Proteinen im Einzelhandel gibt, wurden in den Warenwirtschaftssystemen entsprechende Strukturen geschaffen, um das auszuspielen.
Wie verbindlich ist die Erfüllung der Zielwerte?
Am Ende des Tages geht es um den Gesamterfolg der Allianz. In Summe wollen wir die ausgerufenen Ziele bis 2030 erreichen. Das heißt, jedes Mitglied strebt die Zielerfüllung an und berichtet jährlich über den Status quo. Je nach Indikator werden manche besser abschneiden als andere. Und da wir ambitionierte Ziele gesetzt haben, wird vielleicht auch nicht jedes Mitglied – je nach Sektor – mitziehen können. Doch auch über derartige Herausforderungen und die Gründe wollen wir offen kommunizieren.
Es wird also keine Rückschlüsse auf das Abschneiden der einzelnen Mitglieder geben?
Nein, die Einzelwerte der Mitglieder werden streng vertraulich behandelt. Wenn sie wollen, können sie eigene Erfolge aber darauf basierend gerne selbst kommunizieren.
Du bist Projektleiterin der Allianz, wer ist im Hintergrund beteiligt?
Die gemeinnützige Mutterorganisation dahinter ist Project Together, ein Team aus 55 Mitarbeitenden, das verschiedene Missionen verfolgt, z. B. im Bereich Migration, Kreislaufwirtschaft oder Technologie. Auf diese Ressorts können wir ebenfalls zugreifen.
Der Bereich Gemeinschaftsgastronomie ist angesiedelt in der Mission Farm-Food-Climate und deren siebenköpfigem Team.
Ist die Mitgliedschaft kostenpflichtig?
Ja, allerdings gestaffelt nach Jahresumsatz. Es gibt vier Kategorien zwischen 200 Euro und 2.500 Euro jährlich. Der Hintergrund ist der, dass wir als gemeinnützige Organisation derzeit zwar noch durch Stiftungen und Einzelpersonen finanziert. Doch um perspektivisch weiter unabhängig arbeiten zu können, sind wir irgendwann auf Mitgliedsbeiträge angewiesen.
Seit April nehmen wir übrigens zusätzliche Mitglieder auf.
Wie bist du selbst zum Thema Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsgastronomie gekommen?
Als bin Internistin geworden mit dem Ziel Menschen gesund zu machen. Doch in der Praxis habe ich gemäß der Schulmedizin vieles rein symptomatisch behandelt, von Blutdruck über Herzinfarkt bis hin zu Stoffwechselerkrankungen. Das reichte mir nicht. Ich wollte bei den Ursachen ansetzen, habe Ayurveda-Medizin studiert und mich komplementär-medizinisch weitergebildet. Im Ayurveda ist Ernährung die stärkste Säule für die persönliche Gesundheit.
Das hat gut zu meiner persönlichen Leidenschaft für Ernährung unter Nachhaltigkeitsaspekten gepasst. Zudem lehrt Ayurveda, dass wir nur in Harmonie mit uns selbst leben können, wenn wir in Harmonie mit der Natur sind. Folglich ist Essen ein starker Anker für uns, uns mit unserer Umwelt zu verbinden.
Im Anschluss habe ich sehr viel Ernährungsberatung gemacht.
Dann an der Charité in Forschung und Lehre gearbeitet.
Ein Schlüsselerlebnis für mich war, als eine Kantine auf mich zukam und fragte, wie sie die Planetary Health Diet am besten umsetzen könne. Und ich dachte, ja, genau hier haben wir die Möglichkeit, Menschen zu inspirieren, ohne sie zu bevormunden. Zudem steckt im Außer-Haus-Markt so eine große Kaufkraft, dass damit auch Veränderungen in Landwirtschaft und den Wertschöpfungsketten angestoßen werden können.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
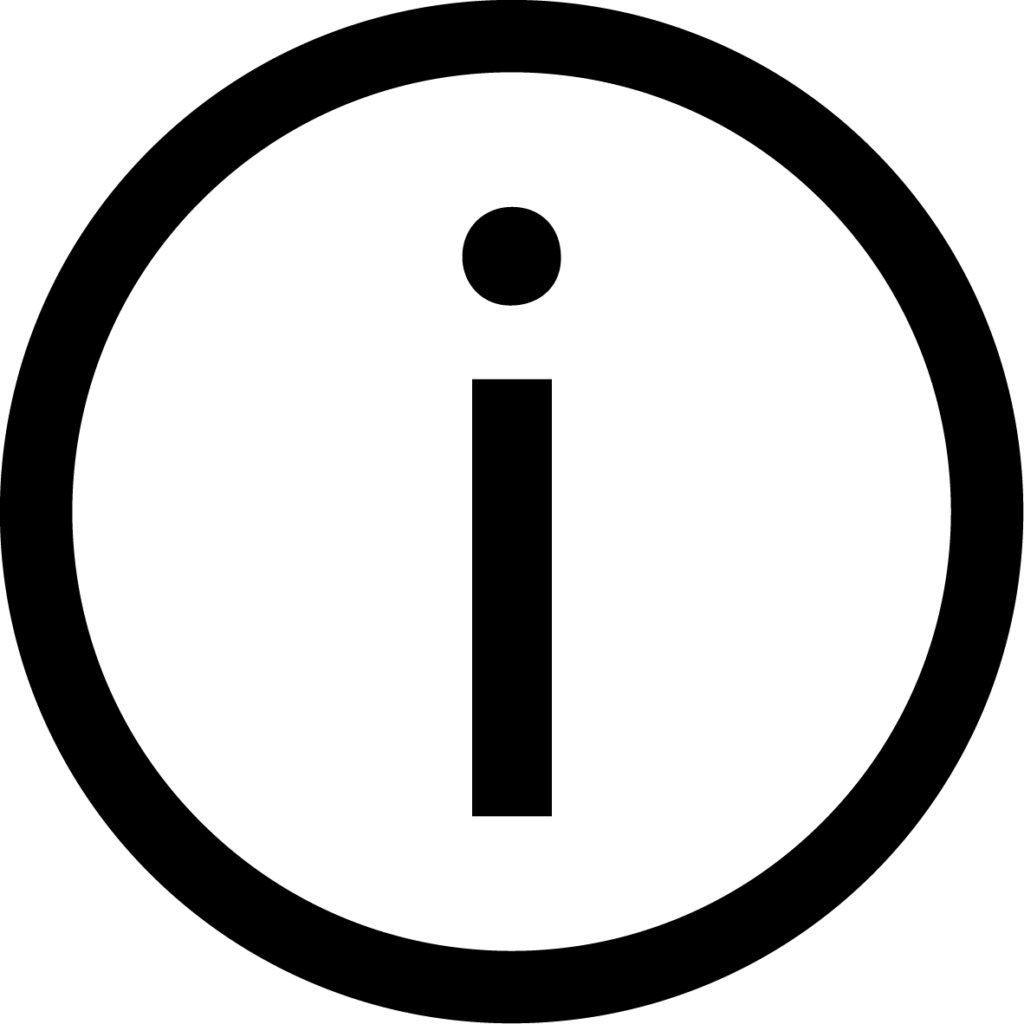
Studie: Nachhaltigkeit
der Speisenproduktionssysteme
Die Autorinnen der Studie aus dem DGE-Ernährungsbericht über die Nachhaltigkeit von Speisenproduktionssystemen beantworten uns in diesem Beitrag häufige Fragen dazu.
Quelle: B&L MedienGesellschaft












