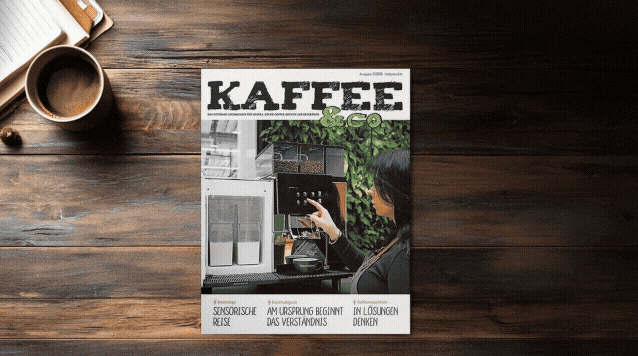Wer einen Kredit braucht, der sollte ab sofort nachweisen können, dass er auch nachhaltig agiert. Ein expliziter Nachhaltigkeitsbericht wird ab 2025 – nach den ersten Großkonzernen – auch für viele Betriebe im Gesundheitswesen, wie Kliniken, verbindlich. Wir geben Tipps, wie Großküchen sich darauf vorbereiten sollten.

„Die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ist vielleicht auch eine Chance für die Küche, damit die Einrichtung eine nachhaltige Visitenkarte nach außen abgeben kann. Dies kann zu einer ganz neuen Kosten-Nutzen-Bewertung führen.“
Prof. Dr. Björn Maier, Studiengangsleiter und Professor für BWL – Gesundheitsmanagement, DHBW Mannheim
Als Experten zum Thema hat die Redaktion GVMANAGER Prof. Björn Maier befragt. Er hat bereits vor über 20 Jahren zum Thema Sustainability und Klimaveränderungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht promoviert. Seitdem hat sich einiges verändert. „Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein idealistisches Ziel oder ein ‚nice to have‘ in einer marktorientierten Unternehmensführung, sondern fest in wirtschaftliche und regulatorische Strukturen eingebettet“, betont der Studiengangsleiter und Professor für BWL – Gesundheitsmanagement an der DHBW Mannheim.
Ein prägnantes Beispiel ist die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Kreditvergabe: Der EU-Aktionsplan Sustainable Finance verpflichtet Banken, ökologische und soziale Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Davon sind auch Großküchen betroffen, sollten sie Um- oder Neubauten finanzieren müssen.
Was das konkret bedeutet? Wie können sich Großküchen vorbereiten? Mehr dazu hat uns Prof. Björn Maier im Interview berichtet.
Nachgefragt bei: Prof. Dr. Björn Maier
Herr Maier, bereits seit 2024 hat Nachhaltigkeit Einfluss auf die Kreditvergabe durch Banken. Was bedeutet das für die Branche der Gemeinschaftsgastronomie und für Großküchen?
Die Kreditvergabe orientiert sich zunehmend an den Vorgaben des EU-Aktionsplans Sustainable Finance, der Banken dazu verpflichtet, ökologische und soziale Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Ziel ist es, Kapitalströme in nachhaltige Wirtschaftsbereiche zu lenken und gleichzeitig das Risiko von Investitionen in nicht nachhaltige Geschäftsmodelle zu minimieren.
Unternehmen müssen daher nachweisen, dass sie nachhaltige Standards erfüllen, was sowohl ökologische Aspekte wie Energieeffizienz und Klimaschutz als auch soziale Kriterien umfasst.
Diese Regelung betrifft bereits große kapitalmarktorientierte Unternehmen wie die DAX-Konzerne oder auch Helios; seit dem Berichtsjahr 2025 ist es aber auch für viele Betriebe im Gesundheitswesen verbindlich.
Doch Nachhaltigkeit spielt in der Gemeinschaftsverpflegung bereits eine wachsende Rolle. Dabei müssen die Betriebe Nachhaltigkeit nicht nur als Pflicht, sondern auch als Chance begreifen, um ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu sichern und gleichzeitig als zukunftsfähige, nachhaltige Dienstleister zu agieren. Wer jetzt in nachhaltige Lösungen investiert und diese transparent dokumentiert, positioniert sich langfristig als attraktiver Partner für Banken und Kunden gleichermaßen.
Wer ist generell betroffen?
Generell sind Unternehmen betroffen, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen, eine Bilanzsumme von 25 Mio. Euro haben oder mehr als 50 Mio. Euro Umsatz machen. Zwei dieser drei Kriterien begründen dann die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Besonders Hochenergiebetriebe wie Krankenhäuser oder Industriekonzerne stehen vor der Herausforderung, soziale und ökologische Standards trotz ihrer energieintensiven Prozesse zu erfüllen. Die soziale Taxonomie erfordert dabei nicht nur Berichterstattung, sondern auch messbare Fortschritte.
Sind Krankenhäuser, aber auch z. B. Industriekonzerne, nicht insofern benachteiligt, da sie generell Hochenergiebetriebe sind?
Krankenhäuser und Industriekonzerne stehen in der Tat vor besonderen Herausforderungen. Sie benötigen Energie für wesentliche Kernprozesse, wie den Betrieb medizinischer Geräte, Heizung, Lüftung, Beleuchtung oder energieintensive Produktionsanlagen. Dies macht es schwieriger, sich nachhaltig auszurichten, da die Möglichkeiten zur Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen oft begrenzter sind als in weniger energieintensiven Branchen.
Welche Tipps haben Sie für diese?
Die Entwicklung von Innovationslösungen, der Fokus auf Energieeffizienz sowie der strategische Einsatz von Förderprogrammen und Kompensationsmaßnahmen können helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele trotz des hohen Energiebedarfs zu erreichen.
Wichtig ist eine langfristige Planung, die Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie sieht. Helfen würde natürlich – gerade Gesundheitseinrichtungen – auch eine soziale Taxonomie, die ihre sozialen Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit auch würdigen und sie kreditfähiger machen würde.
Gehen wir mal einen Schritt weiter: Was bedeutet die Pflicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung konkret für die Küche,
z. B. der Klinik? Können und sollten sich Verpflegungsbetriebe bereits vorbereiten?
Für die Verpflegung in Kliniken bedeutet dies konkret, dass neue Berichtsanforderungen auf Basis der doppelten Wesentlichkeit entstehen. Es geht darum, die wichtigen und in ihren Wirkungen relevanten ökologischen und sozialen Auswirkungen gleichermaßen zu berücksichtigen.
Obwohl es noch keine etablierten Beispiele gibt, können sich Verpflegungsbetriebe bereits jetzt vorbereiten. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) bietet Orientierung mit 20 Kriterien zum Nachhaltigkeitsmanagement und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. In der DNK-Datenbank findet man Beispiele von über 1.000 Unternehmen, die in den letzten Jahren begonnen haben, nachhaltiger zu agieren. Ein großer Fundus an Zielen und Maßnahmen.
Das heißt, die Küche sollte ihre Ziele und ihre Philosophie schriftlich niederschreiben und offenlegen? Was wäre das beispielsweise?
Ja, die Küche sollte ihre Nachhaltigkeitsziele und Philosophie klar definieren und dokumentieren. Beispiele sind:
- Erhöhung des Bio-Anteils auf 30 Prozent bis 2025,
- Reduktion des Fleischkonsums um 20 Prozent durch verstärkte vegetarische Angebote,
- Minimierung von Lebensmittelabfällen durch gezielte Planung und Verwendung regionaler Produkte.
Diese Ziele sollten Teil einer Strategie sein, um ökologische Verantwortung sichtbar zu machen und eine nachhaltige Verpflegung zu fördern. Entgegen der landläufigen Meinung, haben einige Projekte in Kliniken zuletzt sogar darauf hingewiesen, dass eine vegetarische Ernährung auch noch zu geringeren Kosten führen kann.
Sind auch konkrete Zahlen gefordert, wie der Energieverbrauch der Geräte? Und wie genau muss man das messen?
Im Bereich der Nachhaltigkeit werden von Verpflegungsbetrieben immer konkretere Zahlen und Kennwerte gefordert, um ihre ökologische und soziale Verantwortung transparent zu machen. Im Fokus stehen dabei:
- Daten zu Energieverbrauch,
- Daten zu Emissionen und Ressourcenmanagement,
- aber auch zum Umgang mit Mitarbeitenden und
- zum Umgang mit anderen Stakeholdern.
Zentral sind natürlich Daten zum Verbrauch von Energie und Stoffen, die zu Treibhausgasemission führen. Diese sind in drei unterschiedlichen Scopes zu bilanzieren und dann auch entsprechend zu steuern, das bedeutet: vermeiden, vermindern oder kompensieren.
Darüber hinaus werden Angaben zu weiteren Nachhaltigkeitsaspekten wie Wasserverbrauch, Abfallmengen, Einsatz von regionalen und biologischen Lebensmitteln sowie soziale Kennzahlen wie Arbeitsbedingungen oder Lieferantenstandards erwartet.
Welchen Tipp haben Sie zur Bilanzierung von Treibhausgasen für Großküchen?
Es gibt verschiedene Treibhausgasrechner, mit denen Unternehmen und Betriebe ihren CO2-Fußabdruck ermitteln können. Sie helfen, die klimarelevanten Emissionen von Produkten, Prozessen oder gesamten Betrieben transparent darzustellen und Einsparpotenziale zu identifizieren.
Ein Beispiel speziell für die Gastronomiebranche ist das Tool von Eaternity. Es berechnet den CO2-Fußabdruck von Gerichten auf Basis der Zutaten und berücksichtigt Aspekte wie Transport, Herstellung und Verarbeitung. So können Verpflegungsbetriebe klimafreundlichere Speisepläne erstellen und kommunizieren.
Ein weiteres Beispiel ist der Klimeg-Rechner, der besonders für Kliniken geeignet ist. Es ermöglicht die umfassende Bilanzierung von Emissionen auf Basis der betrieblichen Strukturen und Prozesse. Klimeg bietet dabei eine tiefere Einbindung in den Gesamtbetrieb, um auch komplexe Emissionsquellen systematisch zu erfassen.
Beide Tools helfen, Nachhaltigkeitsziele messbar und umsetzbar zu machen. Diese Tools berücksichtigen verschiedene Emissionsquellen, von direkten Aktivitäten bis hin zur gesamten Wertschöpfungskette (Scope 1-3).
Was verbirgt sich hinter den drei Scopes?
- Scope-1-Emissionen umfassen alle direkten Emissionen, die aus unternehmenseigenen Quellen stammen, z. B. durch firmeneigene Lieferfahrzeuge oder Heizungsanlagen.
- Zu Scope-2-Emissionen gehören Emissionen aus eingekaufter Energie, wie Strom oder Wärme, die für den Betrieb der Küche benötigt werden.
- Die Scope-3-Emissionen sind am umfangreichsten und betreffen indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, z. B. durch die Herstellung und Lieferung der verarbeiteten Lebensmittel.
„Interessanterweise macht die Speisenversorgung der Mitarbeiter und Patienten oft nur einen geringen Anteil an der Gesamtbilanz aus, dennoch kann sie als Positivbeispiel für die Außenkommunikation dienen und man kann hier sehr schön zeigen, welche Effekte die Umstellung eines Betriebs mit sich bringt.“
Muss der Betrieb wirklich detailliert Zählen, Messen und Wiegen oder kommt er auch anders zu den geforderten Werten für die Treibhausgasbilanz?
Man unterscheidet die Top-Down- und die Bottom-Up-Bilanz.
- Die Bottom-Up-Bilanz ist genauer, aber auch deutlich aufwändiger. So muss hier jede Kleinigkeit entlang der Wertschöpfungskette gemessen werden.
- Ich empfehle daher die Top-Down-Bilanz, wobei die CO2-Emissionen abgeschätzt werden. Das nimmt viel Druck aus diesem komplexen Thema raus. Die geforderten Werte für die Treibhausgasbilanz werden hier über eine Top-Down-Methode ermittelt. Dabei werden die Emissionen auf Basis von Kosten geschätzt. Diese Methode ist weniger zeitaufwändig und nähert sich den CO2-Werten durch allgemeine Durchschnittswerte oder Branchenstandards an. Unterstützende Tools können dabei helfen, Werte direkt aus der Gewinn- und Verlustrechnung zu extrahieren und zu berechnen.
Gibt es erste Orientierungswerte?
Erste Orientierung, wie es funktioniert und was beachtet werden muss, bieten die Treibhausgasbilanzen, wie sie in Frankreich schon seit über einem Jahrzehnt erstellt werden.
Auch deutsche Kliniken, z. B. das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf oder das Uniklinikum Heidelberg, haben solche Bilanzen erstellt – wenn auch teilweise unvollständig, besonders bei Scope 3.
Interessanterweise macht die Speisenversorgung der Mitarbeiter und Patienten oft nur einen geringen Anteil an der Gesamtbilanz aus, dennoch kann sie als Positivbeispiel für die Außenkommunikation dienen und man kann hier sehr schön zeigen, welche Effekte die Umstellung eines Betriebs mit sich bringt.
Wie lautet Ihr Fazit?
In Kliniken gibt es deutlich wichtigere Teilbereiche, die Einfluss auf die THG-Bilanz haben, als die Großküche. Aber: Die Geschäftsleitung braucht in puncto Nachhaltigkeit auch meist ein Positivbeispiel für die Außenkommunikation. Hier kann sich der Verpflegungsbereich etablieren und zur Visitenkarte der Klinik werden.
Die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bringt auf jeden Fall Bewegung in die Thematik und ist vielleicht auch eine Chance für die Küche, damit die Einrichtung eine nachhaltige Visitenkarte nach außen abgeben kann. Dies kann zu einer ganz neuen Kosten-Nutzen-Bewertung führen.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Quelle: B&L MedienGesellschaft
Wie wird man GreenCanteen?
Ekkehart Lehmann beantwortet häufige Fragen rund um die Nachhaltigkeitszertifizierung für die (Gemeinschafts)Gastronomie GreenCanteen. Mehr dazu lesen Sie hier.